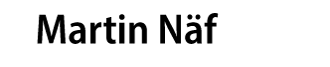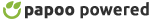Ankunft in der demokratischen Republik Kongo und erste Eindrücke von der Université Panafricaine de la Paix. Januar / Februar 2011
Zäher Anfang in zäher Umgebung
Die kleine Universität mit dem grossen Namen ist noch eine Baustelle. Tagsüber arbeiten immer 6 bis 8 oder mehr Handwerker im und vor dem Haus. Acht Räume einschliesslich einer einfachen Küche sind bereits in Betrieb; an einem Anbau mit weiteren vier Schulräumen wird gearbeitet. Mein Zimmer und das Klo nebenan scheinen erst vor Kurzem fertig geworden zu sein. Es riecht noch alles nach Holz und Farbe.
Das ist sie, die kleine Universität mit dem grossen Namen!

Mein Zimmer in der Universität

Die neuen Toiletten, der Stolz der UPP. Spendengelder aus der Schweiz haben's möglich gemacht.
Die Einrichtung ist einfach, aber ansprechend. Das Bett riesig, die Matratze halbwegs bequem und auch einn Moskitonetz ist da. Ich nehme alles nur flüchtig war. Flory, der Gründer der Panafrican Peace University , der mich gestern am Bujumbura international Airport im benachbarten Burundi abgeholt hat, stellt mich Robert und Patric vor, den beiden Vizedirektoren der UPP. Zwanzig Minuten später gibt's eine Vorstellungs- und Fragerunde mit den rund 20 meist jungen Menschen, die hier studieren. Einige fallen mir auf: Alain, der "Porte de Parole", also der Sprecher der Truppe, und Remy, ein Skeptiker, der alles gerne genau wissen möchte ...
Später muss Patrik, der für das Akademische zuständig ist, leider weg. Er fühlt sich nicht gut und wird am Montag wiedr kommen. Er sollte mich eigentlich einführen und coachen, aber daraus wird vorläufig nichts. Ehe er geht versuche ich noch zwei drei wichtige Fragen mit ihm zu klären, damit ich mich wenigstens grob auf die Kurse vorbereiten kann, die ich geben soll. Sehr viel schlauer bin ich nicht, doch haben wir uns zumindest darauf geeinigt, dass ich ab kommendem Montag, dem 31. Januar jeden Nachmittag eine Doppelstunde "Psychologie Générale" und eine Doppelstunde Englisch für Fortgeschrittene geben werde. Dann müssen Patric und Flory zurück nach Burundi. Die Grenze schliesst um 18:00 Uhr; wer noch rüber kommen will, muss sich sputen!
Robert bleibt länger, undd nachdem es allmählich ruhig geworden ist im Haus unterhalten wir uns sehr interessant und angenehm. Er hat eine leicht behinderte Freundin, und er ist deshalb an allem interessiert, was mit Behinderungen und Behindertsein zusammenhängt.. Er ist mein eigentlicher Betreuer und Berater hier am Ort,, zumindest für die erste Zeit. Er und alle andern kümmern sich rührend um mich. Dabei dauert es allerdings manchmal eine Weile, bis wir uns verstehen. So musste ich während der ersten Tage immer wieder sagen, dass ich gerne so esse, wie die Menschen hier in Uvira, also einfach und billig. Inzwischen ist die Botschaft einigermassen angekommen, und ich glaube, dass vor allem Robert auch verstanden hat, weshalb ich dies will. Die einzige Ausnahme sind Nesskaffee und frische Mangos. Nesskaffee ist hier ein Luxus, richtigen Kaffee gibt's angeblich überhaupt keinen, und Mangos essen die meisten Menschen hier nur, wenn sie sie dirrekt ernten können. Nur wer zuviel Geld hat kauft Mangos auf dem Markt, auch wenn sie dort relativ billig zu haben sind. Relativ ist eben relativ: Man bezahlt für fünf oder sechs Mangos zwar nur etwa einen Dollar, doch für menschen, die wie die Meisten hier, pro Tag nur zwei oder drei Dollar verdienen ist dies bereits jenseits von gut und böse.
Die ersten Tage hier sind nicht einfach. Zu den übermässigen Höflichkeiten und Steiffheiten im Alltag kommt die Tatsache, dass wir hier nur am Montag und Dienstag Strom haben. Während der andern Tage muss ich mein Netbook nach drei oder vier Stunden jeweils Im Lagerhaus der Blauhelme, welches uns gegenüber liegt, aufladen lassen. Auch mit der Internetverbindung happert es. Hier im Haus gibt es keine und das nächste brauchbare Cyber-Kaffee ist etwa 400 kongolesische Francs oder ZWANZIG Minuten per Mototaxi von hier entfernt.

Seit einigen Jahren wimmelt es in Uvira von Moto-Taxis - schnell und relativ preiswert
Ich habe mir deshalb ein USB-Modem gekauft und nach einem Fehlschlag habe ich jetzt tatsächlich einen direkten Zugang zum Internet. Allerdings ist die Verbindung so lausig, dass ich damit gerademal meine Mails lesen und vershicken kann. Das Öffnen der meisten Webseiten dauert ewig, falls sie überhaupt geöffnet werden können. Damit bin ich sowohl im Schreiben als auch im Recherchieren und in der Kontaktaufnahme mit aussen sehr eingeschränkt. Dabei könnte und möchte ich gerade in der Richtung sehr viel für die UPP tun, und auch für meine privaten Vergnügen - lesen, schreiben, Musik hören, durch die virtuellen Weiten der Welt surfen, mit meinen Freunden und Freundinnen kommunizieren - brauche ich Strom.
Ich empfinde die Einschränkung doppelt, weil hier zumindest bis jetzt nicht viel los ist. Ausser mir wohnt niemand in der UPP; nach acht Uhr scheint ganz Uvira im Bett zu sein; interessante Besuche und Querverbindungen zu anderen Orten und Menschen in der Stadt scheint es nicht zu geben. Tagsüber ist hier zwar ein reges Kommen und Gehen, aber auch dann spüre ich viel Förmlichkeit und Zeremoniell, nicht nur mir gegenüber, sondern auch im Umgang untereinander. Das nimmt einen Teil der Spontaneität und macht alles ein wenig anstrengend. Statt in einer lebendigen Gemeinschaft eingebunden zu sein und mich an vielen neuen Kontakten zu freuen bin ich ziemlich oft in meinem Zimmer und warte auf irgend etwas, was vielleicht geschieht.
Robert sagt, dass er immer für mich da sei, und ich bloss sagen soll, was ich möchte, doch zum einen ist dies nicht dasselbe, wie spontanes Interesse und Freude am Zusammensein; zum andern ist es auch nicht realistisch: Er hat viel anderes zu tun und ist häufig nur halb oder gar nicht da, sodass ichh ihn für"private Dinge" eigentlich nicht in Anspruch nehmen will. Ich bin unzufrieden. Da sich die Infrastruktur hier in den nächsten Monaten vermutlich kaum wesentlich verbessern wird, und ich deshalb in der Richtung wenig tun kann, bräuchte ich eigentlich jemanden, der mir helfen würde, die Dinge in der realen Welt zu tun, die ich gerne tun möchte angefangen von einem Kurzen Bad im 100 Meter entfernten prächtig warmen Tanganjikasee oder einem ausflug in die nahen Berge bis hin zum Einkaufen auf dem Marktt oder zu Besuchen bei irgendwelchen Menschen und Institutionen in der Umgebung. Vielleicht werde ich mit der zeit ja selbstständiger, doch im Augenblick ...
Ich versuche Robert meine Situation zu erklären. Er versteht zuerst nicht, doch als ich ihm am Montag früh noch einmal sage, dass ich gewohnt sei, mich zu bewegen, mich selber um meine Sachen zu kümmern, zu kochen, einzukaufen, meine Kleider zu waschen oder irgendwelche Menschen zu besuchen, Musik zu machen oder zu lesen etc., , beginnt er zu begreifen. Ich sage ihm dass ich überlegt habe, einen der Studierenden, die hier fast alle zusätzlich arbeiten müssen, um über die Runden zu kommen, als Assistentten anzustellen. Robert überlegt und schlägt dann vor, statt dessen ein paar Studierende zu finden, die diese Arbeit freiwillig übernehmen würden. Erstens erwarte die UPP von ihren StudentInnen, dass sie sich auch dann für ihre Uni und die Welt um sie herum einsetzen, wenn sie dafür kein geld bekommen, und zweitens sei diese "Arbeit" für die Studierenden ja auch eine grosse Bereicherung, denn sie biete ihnen Gelegenheit viel zu erfahren und zu lernen, was sie sonst vielleicht nicht erfahren und lernen würden. ich bin einverstanden, und Robert präsentiert mir am Abend Kipoussa, Babu, Alain und Massemo, die sich seither in festem Turnus um mich kümmern.
Am Nachmittag desselben Tages unterrichte ich zum ersten mal: von 14:00 bis 16:00 Allgemeine Psychologie und von 16:00 bis 18:00 Englisch - so zumindest habe ich es mit Patrik und Robert abgemacht. In Wirklichkeit fallen die Stunden häufig aus, und wir fangen eigentlich immer mindestens eine Viertelstunde zu spät an. Das ist eines der Dinge, die mir am hiesigen Betrieb nicht gefallen, doch ich bin ja erst ein paar Tage hier, und gut Ding will bekanntlich Weile haben. Dass Robert, mit dem ich mir den englischkurs teile, gleich am ersten Unterrichtstag statt um 16:00 erst um 17:00 kommt finde ich allerdings doch etwas krass. Ich bin freundlich und sage nichts, doch innerlich blubbert's zum ersten Mal bedenklich im Vulkan der ungeduld.

Das ist unser Generator. Grosser Retter in der Not - viel Lärm und wenig Leistung

Jacque, Charlie, Ibrahim und Martin im Büro
Die Association des Aveugles d'Uvira; die Blindenschule, Blindenschrift als Sackgasse und Madame Lundimo
Am Dienstag um acht Uhr in der Früh steht Kipoussa, einer meiner Assistenten, in meinem Zimmer. Er hat sich bereits etwas für mich ausgedacht. Er schlägt vor, dass wir nach dem Frühstück in die in der Nähe gelegene Blindenschule gehen können. Ich bin erstaunt, dass es hier so etwas gibt, denn ein blinder Mann und seine Tochter, die mich am vergangenen Donnerstag, meinem zweiten Tag in uvira, besucht haben, haben Robert und mir erklärt, das es in uvira keine Einrichtung für blinde menschen gäbe. Keine, nur Isolation und Armut. Hie und da komme jemand von der katholischen Kirche bei den Blinden vorbei und gäbe ihnen etwas Zucker oder Mehl, doch das sei alles. Es gäbe keinen Ort, an dem sie sich treffen können, und es gäbe niemand, der solche Treffen organisieren und leiten würde. Alle seien resigniert, und wenn sie, wie zum letzten Mal anlässlich des Tags der Behinderten etwas unternehmen würden, seien die Reaktionen so, dass sie wieder für eine Weile ganz entmutigt seien. Am Ende dieser Diskussion beschlossen wir, am 8. Februar in der UPP eine Versammlung aller blinden Menschen und ihrer Freunde durchzuführen, in denen wir über alle Nöte und Wünsche sprechen und ein Kommittee wählen wollen, welches bereit ist, sich regelmässig zu treffen und sich aktiv für die Verbesserung der Situation blinder und sehbehinderter Menschen einzusetzen. Das war vor einigen Tagen, und jetzt sagt Kipoussa, dass es hier eine Blindenschule gibt. Weshalb weiss er davon und Robert nicht? Wie gut sind Flori und Robert hier verankert? Wie viel Austausch haben sie mit ihren StudentInnen?
Die Blindenschule ist eigentlich keine Blindenschule, sondern eine Schule für blinde und taube, eine Kombination, die bei uns in den Anfängen der Blindenbildung vor 200 Jahren ebenfalls üblich war, und die mir auch in Nouakchott begegnet ist. Im Vergleich zu den 32 Taubstummen SchülerInnen bilden die acht blinden Kinder und Jugendlichen eine kleine Gruppe. Sie werden in vier Klassen unterrichtet und leben grossenteils in der Schule. Nur ein oder zwei Schüler und eine Anzahl der Lehrkräfte wohnen ausserhalb der Schule. Der Direktor des Zentrums, ein gewisser Pfarrer Kisosse, erzählt, dass es im Kongo insgesamt etwa zehn Blindenschulen gäbe, davon befinden sich drei in der Hauptstadt Kinshassa. Die Tatsache, dass sie in ihrer Schule nur acht blinde SchülerInnen haben, erklärt er damit, dass viele Eltern nicht daran glauben, dass ihr blindes Kind jemals etwas lernen könne. Viele wollten ihr Kind auch deshalb nicht in die Schule geben, weil es als Bettler zum Unterhalt der Familie beiträgt und man nicht freiwillig und ohne Entgeld auf diese Einnahmequelle verzichten will oder kann. Schliesslich müssten sie jedoch noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten als bisher.
Pfarrer Kisosse scheint gute Kontakte zu europäischen GeldgeberInnen zu haben. Er erwähnt eine holländische Stiftung (Stiftung Vivian oder so ähnlich), die Christophel Blindenmission und die Mission Evangelique Braille, welche auch der Blindenschule in Ouaga hilft. Die Schule konnte vor ein paar Jahren bauen und ist seither in eigenen Räumen untergebracht. Ich spreche mit Pfarrer Kisosse und dem Sekretär und besuche nachher die vier Klassen. Mit einigen der Kinder komme ich leicht und schnell in Kontakt, einige wirken verstört und kaum ansprechbar. Alle haben ihrgendwelche Blindenschriftpapiere vor sich liegen. Man arbeitet mit Stichel und Tafel. Die Schule besitzt zwar zwei Perkins Maschinen, auf denen die älteren SchülerInnen auch zu schreiben lernen, doch da sie später mit grösster Wahrscheinlichkeit keine Perkins Maschine besitzen werden, will man sie nicht zu sehr an diese gewöhnen.
Im Prinzip sollen die SchülerInnen nach der Primarschule in die Sekundarstufe der normalen Schule überwechseln. Wie oft und wie gut dies gelingt weiss ich nicht. Pharrer Kisosse spricht vage von einigen blinden Sekundarschülern und von einem oder zwei blinden Universitätsabsolventen.
Bücher aller art sind rar. Es gibt ein paar biblische Texte in Blindenschrift, dazu ein oder zwei Hefte mit weltlichem Inhalt sowie eine Systematik der Blindenschrift. Pfarrer Kisosse spricht von seinem Wunsch, einen Blindenschriftdrucker für die Schule zu erwerben, um das notwendige Schulmaterial vor Ort produzieren zu können. Es ist wie in Nouakchott oder Ouaga: Man denkt an die eigenen Bedürfnisse. Von einer Zusammenarbeit mit anderen Initiativen im Land oder gar mit anderen Staaten ist keine Rede. Die afrikanische Blindenunionn oder die Blindenunion der frankophonen Ländr Afrikas, von der mir der Präsident der Mauretanischen Association des Aveugles erzählt hat, scheinen im Alltag dieser Institutionen oder in der Arbeit ihrer Direktoren keine Rolle zu spielen.
Ein zweites, was mir auch jetzt wieder auffält, ist die problematische Fixierung auf die Blindenschrift, denn so wichtig diese ist, so ungeeignet ist sie doch dort, wo es um den möglichst leichten Zugang zu einer breiten Auswahl von Lesestoff geht. wie schon in Nouakchott und Ouaga frage ich deshalb auch hier nach Audiomaterial und stelle fest, dass man sich in der Richtung noch überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Die SchülerInnen sagen mir anlässlich eines zweiten Besuches einige Tage später, dass sie von so was noch nie gehört hätten, dass sie jedoch sofort dabei wären, wenn sie auf diese Weise Zugang zu Büchern, vielen, vielen Büchern erhaltten könnten. So wie bereits während meiner Gespräche mit Lucien Naré in Ouaga denke ich auch jetzt wiedr an die Schaffung einer Bibliothèque Sonore des Pays francophones de l'Afrique oder ein ähnliches Projekt, und ich bedaure es, dass ich wegen der schlechten Internetanbindung in der UPP nicht sofort mit entsprechenden Recherchen und Abklärungen beginnen kann. Als ich Alain, einem anderen meiner Hellfer, ein paar Tage später von der Idee erzähle, sagt er sofort, dass eine solche Bibliothek auch für die vielen AnalphabetInnen Uviras eine interessante Sache wäre. Tatsächlich vergisst man ja auch dort vor lauter Fixierung auf das traditionelle Lesen und Schreiben, dass es bei der Alphabetisierung ja auch, wenn nicht sogar zu allererst, um den Zugang zu Kultur und Wissen geht, egal, ob dieser Zugang über Schriftzeichen oder über Hörbücher und Hörzeitschriften geschaffen wird. Alain ist ein kluger Kopf; ich stelle mir sofort eine Kooperation mit der hiesigen Stadtbibliothek oder eine von blinden Menschen betriebene öffentliche Hörbücherei vor, doch zuerst möchte ich wirklich mehr recherchieren, denn vielleicht gibt es ja bereits irgendwo ein solches Projekt!
Eine Geschichte, die Pfarrer Kisosse erzählt, ist typisch für die vielen Hinddernisse, mit denen man hier zu kämpfen hat. Es geht um Schulbücher. Eine belgische Institution hat vor einigen Jahren ein in der Primarschule des Kongo benütztes Buch in Punktschrift übertragen und vor rund zwei Jahren nach Kinshasa geschickt. Die Sendung enthalte auch einige für Uvira bestimmte Exemplare, doch seien diese bis heute nicht bei ihnen angekommen, weil der Postverkehr im Kongo nicht funktioniert und man deshalb irgend eine andere Transportmöglichkeit finden muss. Eine Organisation, ich weiss nicht mehr ob es die UNICEF oder das rote Kreuz war, wollte den Transport übernehmen, doch dann wurde der Mitarbeiter, der sich um die Sache kümmerte, versetzt, sodas sie sich jetzt nach einer neuen Transportmöglichkeit umsehen müssen. Im Verlauf des Gesprächs schlage ich vor, dass man die Bücher von Kinshasa wieder zurück nach Europa und von dort nach Bujumbura schicken könnte, da der Pfarrer erzählt hat, dass die Schule eine Postanschrift in Bujumbura hat, und dass die Post von Europa nach Burundi problemlos funktioniere, und "Blindensendungen" auch in Afrika prinzipiell kostenlos sind. Der Pfarrer sagt, das wäre vielleicht wirklich eine Lösung. Dann fragt er michh danach, was ich ihnen für Ratschläge geben könne. Ich lache, denn es ist eine Frage, die man mir hier in Afrika immer wieder stellt. Dabei habe ich oft das Gefühl, dass man überhaupt nicht daran denkt, die Ratschläge in die Tat umzusetzen, sondern dass man es einfach geniesst, über dies und das zu plaudern. Ich erkläre dem Pfarrer deshalb, dass ich keine weiteren Ratschläge geben würde, bevor ich nicht klar wisse, ob er den Ratschlag betreffend der in Kingshasa liegenden Schulbücher in die Tat umgesetzt habe oder nicht. Natürlich drücke ich mich zartfühlend diplomatisch aus, doch ich habe tatsächlich keine grosse Lust mehr mir Lösungen für Probleme auszudenken, an deren Lösung mein Gegenüber in Wirklichkeit gar nicht interessiert ist. Im übrigen weiss ich nicht, wie vertrauenswürdig der sympathische Pastor wirklich ist, da in Afrika leider sehr viel Spendengelder in den Taschen irgendwelcher Herren verschwinden.
Einige Tage nach meinem Besuch in der Blindenschule besucht mich Frau Lundimo, eine blinde Lehrerin, der ich dort kurz die Hand gedrückt habe. Wir sprechen u.a. über die geplante Versammlung und die Gründung einer Association des Aveugles de Uvira. Sie ist sehr einverstanden, meint jedoch, dass es gut sei, wenn diese Association von der Schule unabhängig sei. Was mögliche aktivitäten angeht, denkt sie vor allem an Projekte im Bereich der beruflichen Ausbildung und an die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten. Sie selbst ist erst vor kurzem als Schülerin an die hiesige Blindenschule gekommen und wurde nach dem Tod eines ihrer Lehrer wider Erwarten gefragt, ob sie nicht dessen Stelle übernehmen wolle. Früher habe sie u.a. Hühner und Ziegen gehalten, um sich und ihre jüngeren Geschwister über die Runden zu bringen. Das sei durchaus eine Arbeitsmöglichkeit für blinde Menschen. Sie selbst hatte allerdings Pech, denn so wie der blinden Frau in Gibo, wurden auch ihr die Ziegen und einige Hühner gestohlen! - ich bin gespannt, wie sich diese Sache in den nächsten Wochen entwickelt.
Die Zukunft der UPP; Luftschlösser am See und ein wichtiger Schritt
Die Idee mit den Helfern - es sind keine Frauen unter ihnen - bewährt sich. Allerdings ist mein Leben hier auch in der zweiten Woche eher anstrengend, und meine Eindrücke von der UPP bleiben widersprüchlich: Das Projekt könnte äusserst spannend werden, wenn wir uns auf seinen grundsätzlichen Charakter einigen könnten. Zu dem Zweck möchte ich bald einmal mit Flory, Robert und Patrik sprechen. Zur Zeit ist der Betrieb hier eher konventionell. Obwohl man eine von den StudentInnen und ihren Interessen getragene Lerngemeinschaft sein will, werden die SchülerInnen kaum in die Gestaltung und den Ausbau der Uni einbezogen, und die Lerninhalte werden nicht "von unten her" entwickelt, sondern sie entsprechen dem, was man auch an anderen Unis unterrichtet. Zwar versucht man, den Stoff schüler- und praxisnah zu vermitteln, doch das versucht man ja überall. Es ist ein wenig als ob ich die StudentInnen auf das Dach eines Hauses zu hieven versuche, statt sie die Treppen hinaufsteigen zu lassen. Ich glaube, die Uni hat eine echte Chance, wenn man hier mutiger und eindeutiger wäre und nicht von abstrakten Bildungsideen, sondern von der realen Situation der einzelnen StudentInnen und von ihren Bedürfnissen ausgehen würde. Dabei tritt sofort die Frage der Armmut und der Arbeitsmöglichkeiten in den Vordergrund. Ein Gespräch, welches ich vor zwei Tagen mit einigen StudentInnen hatte, war diesbezüglich sehr inspirierend.
Wir sassen nach dem englischkurs am Ufer des Tanganjikasees, um den Tag ausplämpern zu lassen. Dabei brachte ich nebenher die Idee eines kleinen Hotels ins Gespräch, welches wir an diesem schönen See bauen könnten, um damit Geld für die UPP und ihre StudentInnen zu verdienen. Die von meiner Begeisterung für diesen wunderbaren See inspirierte Bemerkung löste eine heftige Diskussion darüber aus, was man alles tun könnte, um die hiesigen Lebensverhältnisse zu verbessern. Dabei waren sich alle Studierenden einig, dass solche Projekte sowohl ihnen selbst und der UPP als auch der hiesigen Bevölkerung zu gute kommen müssten, und dass sich im Rahmen dieser Projekte sehr sehr viel lernen liesse über Management, Community Development, Conflict Resolution, Fund Rising, Economy, Agriculture, Tourism etc. etc.
Mich hat dieses Gespräch ssehr inspiriert: Ich glaube, die StudentInnen wären leicht für eine Umstrukturierung der Uni in diesem Sinn zu haben. Ich glaube auch, dass darin eine echte Chance für diese sonst ziemlich gefährdete Pflanze liegt, denn pädagogische Modelle dieser Art sind selten und die UPP könnte damit wirklich weltweit aufmerksamkeit erregen. Icch weiss allerdings nicht, wie weit diese Ideen im Rahmen der bestehenden Bestimmungen verwirklicht werden können, und in wie weit die leitenden Köpfe der UPP für eine solche Reform ihres Unternehmens zu gewinnen sind. Ich weis auch nicht, ob es uns tatsächlich gelingen würde, unsere Ideen zu funktionierrenden Projekten weiter zu entwickeln, doch ich wäre für einen entsprechenden Versuch in jedem Fall zu haben! So wie die UPP zur Zeit funktioniert, kann ich mich nur bedingt mit ihr identifizieren. Ich erlebe zu viel konventionelles Schülertum, zu viel Pädagogik von oben herab, zu viel Unterricht und zu wenig Initiative von unten, und dazu eine Unmenge administrativer und technischer Probleme. Ich glaube tatsächlich, dass die UPP nur dann überleben wird, wenn sie ein sehr klares pädagogisches Profil entwickelt. Ich meine, auf der Webseite der UPP etwas von Erziehung zur Verantwortlichkeit und von praxisbezogenem Lernen gelesen zu haben. Oder habe ich mir dies nur eingebildet? ich beschliesse, mit Robert, Patric und Flory bald einmal über diese Dinge und meine sonstigen Überlegungen zur UPP zu sprechen. Da Flory in Sachen UPP zur Zeit in Kinshasa ist, muss ich mich noch ein paar Tage gedulden, dochh dann, am dienstag dem 8. Februar, vormittags sitzen wir zusammen und reden. Patric ist noch immer krank, sodass wir nur zu dritt sind.
Ich erzähle von meinen bisherigen eindrücken von der UPP und mache einige Vorschläge, wie die Schulstrukturen modifiziert werden könnten, um der Idee der UPP eher zu entsprechen. Dabei spreche ich vor allem von der Einrichtung einer regelmässigen Schulversammlung als Kern des ganzen Unternehmens. Flory und Robert sind sehr interessiert, und wir beschliessen, eine solche Versammmlung einzuführen. Sie soll bis auf weiteres jede Woche und zwar Montags um 16:00 stattfinden. Ich habe das Gefühl, dass diese Neuerung sehr viel Schwung in die UPP bringen wird. Es ist Partizipation und Mitverantwortung zum Anfassen, nicht als Ideal hoch oben am Himmel, sondern als Realität hier auf der Erde. Ich glaube, es wird gut.
Als zweites beschliessen wir, auch den Unterrichtsbereich in Richtung projektbasiertes Lernen weiterzuentwickeln. Ich habe es übernommen, darüber nachzudenken, was das konkret heissen könnte und meine Gedanken in einem Papier festzuhalten. Flory bittet mich, auch etwas über die theoretischen Grundlagen dieser veränderten Unterrichtsorganisation und über Schulen und Unis zu schreiben, in denen man ähnliche Wege begeht. "Es wäre sehr gut für unsere offizielle Anerkennung, wenn wir dem Ministerium in Kinshasa zeigen können, dass das, was wir hier tun, auch andernorts getan wird, und wir sozusagen in international anerkanntem Kontext arbeiten."
Die Idee vom Mittwoch letzter Woche alles Lernen hier in konkreten Community Development Projekten stattfinden zu lassen, ist inzwischen wieder etwas verblasst. Ich denke, dass konkrete Arbeitsgruppen zum Betrieb der Schule (Bibliothek, Öffentlichkeitsarbeit / Vernetzung, Fundraising etc.), sowie die einführung von Semesterarbeiten und anderen, nicht primär lehrerabhängigen Lernmöglichkeiten zumindest in einer ersten Phase bereits kühn genug sind.
Flory ist sehr froh, dass ich hier bin. Er sagt am Ende unseres Gespräches, dass er und die UPP genau so jemanden wie mich als Berater bräuchten, und ich bin ganz zufrieden, hier einmal von Grund auf mitgestalten und mit entwickeln zu können. Unter diesen Bedingungen fällt es mir auch nicht mehr so schwer, zu akzeptieren, dass vieles noch nicht so ist, wie es sein könnte oder müsste. Wenn wir nur einmal eigenen Strom und eine vernünftige Internetanbindung haben, dann ist der schlimmste Engpass überwunden, und wir können so recht loslegen mit Konzepte schreiben, Informationen Sammeln, Webseite entwickeln, Kontakte spinnen etc. etc.

Kabelsalat vom besten
Wenn ich Paul Geheeb wäre, würde ich jetzt an Adolphe Ferrière oder einen anderen pädagogischen Spinner schreiben: "Gestern hier höchst erfreuliches Gespräch über die Grundsätze der UPP. Mein Vorschlag zur Schaffung einer Schulgemeinde mit grossem Jubel angenommen! Auch sonst sehr ernsthafte Beratung und grosse Bereitschaft zur Umgestaltung des Unterrichtsbetriebes im Sinne des Arbeitsschulprinzips!"
Von Seejungfrauen, Flusspferden, Frauenrechten und Sainas liebe zu den blinden Menschen
Die Beziehung zu den Studierenden entwickelt sich weiterhin gut. Im Psychologiekurs gab's am Montag einen ziemlichen Aufruhr und eine heftige Diskussion über meine Unterrichtsmethode. Ich war nicht dabei, doch hat mein Arbeitsauftrag die Zungen gelöst. Alain, der Porte Parole der Studierenden, hat mir im anschluss daran kurz berichtet. Ein Teil der Studierenden finden meinen stark diskussionsbasierten Unterrichtsstil gut; ein anderer Teil vermisst konkreten Stoff und akademisches Wissen. Anders als früher kann ich gut mit der Unzufriedenheit leben. Die meisten Studierenden kommen direkt von der Schule. Es braucht Zeit, bis sie sich an diese Art des Arbeitens gewöhnt haben. Jetzt, wo ich weiss, dass mein unterrichtsstil der Unterrichtsstil der UPP ist oder doch werden soll, bin ich noch zuversichtlicher und ruhiger. Sie werden bald verstehen, was sie hier tun. Im übrigen habe ich vor zwei Tagen die ersten fünf Seiten der Kurszusammenfassung abgegeben, die auch reichlich Hinweise auf psychologische Theorien und berühmte Namen enthält. Es ist gewissermassen ein Protokoll des Prozesses, den wir als Gruppe durchmachen. Die Diskussionen sind meist sehr lebendig, wenn auch die Hälfte der Studierenden noch immer ziemlich stumm sind. Ich vertraue darauf, dass auch sie allmählich auftauen und Freude an dieser Art des Arbeitens bekommen. Dass ich weiss, dass "die Uni" diesen Stil will und mitträgt tut sehr gut.
Vor allem mit Massemo und Alain, zwei Studenten, die mir jeweils zwei Tage pro Woche als Helfer und Pfadfinder beistehen, habe ich mittlerweile eine sehr gute Beziehung entwickelt. Auch die andern scheinen mich mehrheitlich zu mögen. Massemo ist erfrischend offen und "jung". Er erzählt mir viel über das Leben hier, konkrete Einzelheiten, die mir ein wenig von dem vermitteln, was hier hinter den Kulissen alles los ist. Dabei bekomme ich eine kleine Ahnung davon, wie fremd die Pädagogik, die wir hier verwirklichen wollen, vielen Menschen hier sein muss. Um so wichtiger ist es, dass wir sie nicht über den Kopf, sondern über konkrete Strukturen und über eine bestimmte Art des Lernbetriebs vermitteln. Massemo erzählt beispielsweise davon, dass die meisten jungen Menschen hier schwimmen können, dass man sich aber vor dem Tanganjikasee dennoch etwas fürchte. Nicht nur, dass es in dem See während des Krieges immer wieder Leichen gab, nein. s gibt auch Sirenen, halb Fisch und halb Mensch, die einem in die Tiefe ziehen. Überhaupt ist die Welt hier voller Dämonen und böser Geister. Es gäbe Marabus, die sich mit Flusspferden und Krokodilen verbinden, und aus dieser Verbindung magische Kräfte schöpfen. Nein, das seien keine Geschichten, das sei erwiesen. Zum Beweis berichtet Massemo von einem Flusspferd, welches mit einer Frau in Verbindung stand und vor einigen Jahren von ein paar Soldaten erschossen wurde. Im Augenblick als das Flusspferd starb sei die Frau auf dem Markt tot zusammengebrochen. Zur Bestätigung all des Unheimlichen hören wir noch, dass ein Pater gestern oder vorgestern im See verschwunden ist. Ertrunken oder vielleicht doch von einer Sirene in die Tiefe gezogen? Und dann die Hexerei. Das sei sehr schlimm. Als Christ würde er sich natürlich nicht darauf einlassen, aber leider gäbe es noch immer viele Menschen, die zu den Zauberern laufen und schwarze Magie betrieben. Dass die Marabus einem eine krankheit anhexen können ist für Massemo ebenso selbstverständlich wie die Existenz von Dämonen und Seejungfrauen. "Ja, es ist schlimm; man darf sich einfach nicht darauf einlassen."
Massemo ist wie ein Kind. Er lernt mit Eifer englisch, schreibt alle Worte, die ich sage auf, und entwickelt auch sonst immer mehr Initiative und Mut. Heute haben wir nach dem englischkurs noch lange darüber gesprochen, wie afrikanische Männer ihre Frauen behandeln. Dabei hat er sich als radikaler Vertreter der Frauenemanzipation geoutet. Er und Saia haben mir erklärt, wie die Eltern eines Ehemannes mit den Eltern eines jungen Mädchens vor der Hochzeit über die Höhe des Bbrautgeldes feilschen: drei oder vier Kühe plus 2,500 Dollar! Nein, höchstens zwei Kühe und 2,000 Dollar. Der Umstand, dass man in Afrika für eine Frau bis heute fast überrall bezahlen müsse, führe dazu, dass die Männer ihre Frauen danach tatsächlich als ihr Eigentum empfinden und sie dem entsprechend behanndeln. Es sei natürlich so, dass die Frauen hier viel mehrr arbeiteten als die Männer. Natürlich würden auch die Männer zum Teil hart arbeiten, aber wenn sie vom Feld heimgehen, dann schleppen die Frauen die Lasten und zuhause ruhen die Männer sich aus, während die Frauen Essen machen und die Kinder versorgen, und wenn der Mann am Ende auch gegessen hat, dann darf die Frau ihm noch die Füsse massieren und ihn sonst verwöhnen!

Robert, Zaina und ich am Essen.
"Weisst du, wir sind acht Jungen zuhause, und ich bin der älteste. Keine Mädchen. Da haben wir natürlich auch alle Frauenarbeiten im haus gemacht, und deshalb weiss ich, wieviel Arbeit dieses dauernde Putzen und Kochen macht! Dazu noch die kleinen Kinder, Wasser holen, Brennholz suchen etc. etc. Nein! Ich weiss, wie hart Frauen arbeiten, und ich wünsche mir deshalb, dass sich ihre Lage auch in Afrika verbessert. Heiraten soll man aus Liebe, nicht weil man eine Putzfrau braucht."
Massemo wäre bereit, sich mit seiner Frau in die Hausarbeit zu teilen. "Aber das kannst du in Afrika vergessen. So sehr sich die Frauen hier beklagen, sobald du einen Topf in ihrer Küche anrührst, gibt es Krach. Das ist ihr Revier, da hast du nichts zu suchen." Ich sage ihm, dass es sicher auch in Afrika Frauen gibt, die sich über einen Mann wie ihn freuen würden, vielleicht nicht hier, wo er gross geworden sei, aber an anderen Orten. Frauen, die studiert haben und berufstätig sind. Frauen, die in grösseren Städten aufgewachsen sind ... Er staunt zuerst, scheint dann aber ganz erfreut. Hier in uvira gäbe es kaum jemanden, der so denke wie er. Er spreche deshalb auch nur selten über diese Dinge. Massemo, der mich meist "Papa" nennt und rührend für mich sorgt! Plötzlich ist seine Kindlichkeit wie weggeblasen. In der Hitze des Gefechtes sagt er ungeniert "wart, lass mich ausreden", und dann erklärt er noch einmal, was er meint, damit ich es endlich verstehe!
Es macht Spass, diese Gespräche. Ich staune über das, was ich höre, und ich freue mich an der Lebendigkeit der jungen Menschen. Saia sagt lachend, "Er hat recht. Es ist genau wie er sagt". Dann schaut sie mich ganz verträumt an und seufzt: Martä! Sie fragt, ob ich eigentlich wisse, dass sie mich liebe. Überhaupt,sie liebe blinde Menschen. Die würden so viel reden, so viele gute Worte, so klug und so ermutigend ... Ich lache. "Dann hörst du mir also gerne zu?" "O ja, sehr gerne!" Tatsächlich sagt sie im Kurs beinahe nie etwas,ist aber mit Prusten und Lachen und Zwischenrufen immer voll dabei. Massemo istdünn; seine Hände sind schmal. Saia dagegen ist gross und üppig. Ihre Hände sind kurz und kräftig. Ihre Stimme ist laut, und sie singt für's Leben gerne. Ja,wir könnten etwasafrikanische Unterrichtsmethoden in unseren Psychologiekurs einführen. Schlussfolgerungen und Kernsätze nicht einfach aufschreiben und unterstreichen, sondern sie singen! So mache sie es auch mit den KindergärtlerInnen, die sie am Vormittag unterrichtet: "Eins zwei drei und hier kommt eine Linie hin, Linie hin, Linie hin ...". Wir probieren's gleich zusammen: "La vérité n'est jamais vraie, jamais vraie, jamais vraie, parce qu'il y a toujour une autre position, une autre vérité, une autre vérité ...". Dann kommt Frau Pasteur. Sie ruft "Maia moto" (warmes Wasser)und ich sage Assante sana (herzlichen dank), während sie mein Essen in mein Zimmer bringt.
Es ist fast acht Uhr geworden. Draussen ist es längst dunkel. Der englischkurs war vor zwei Stunden vorüber. Wenn ich ihn seiner Pflichten entbinde, dann werde auch er jetzt heim gehen, sagt Massemo und nimmt den Zettel mit den Englischvokabeln vom Tisch. "Mon Papa, je vous accompagnie dans votre chambre ou ça va" ... Ca va, ça va. Der Papa findet in sein Zimmer, wo er jetzt sitzt und über die Buntheit und Vielschichtigkeit des hiesigen Lebens meditiert.
Psychokurs, Lehrerzweifel und ein schwarzer Samstag. 11./12. Februar
Gestern gab's Test in der Psychologie. Inhalt waren die fünf Seiten Resümé, die ich vor zwei Tagen ausgeteilt habe. Auf allgemeinen Wunsch hin wurde das Examen mündlich durchgeführt. Jede Studentin und jeder Student musste eine Frage beantworrten. Dabei konnte man natürlich Glück odder Pech haben. Dennoch gab es klare Spitzenreiter und andere, die ziemlich verloren wirkten. Massemo und Isak liegen ganz vorne im Rennen. Isak ist der Spezialist für die berühmten Namen, während Massemo ein sehr gutes Gespür für die innere Logik der Themen hat, die wir in dem Kurs besprechen. Die Sitzung war strapaziös, und ich habe am Ende etwas Druck gemacht. Jetzt hätten wir nur geübt, doch wenn es in ein oder zwei wochen wieder einen Test gäbe, dann sei es ernst, und da müssten sie sich besser vorbereiten. "Ihr müsst bei jedem Satz, den ihr in meiner Zusammenfassung lest, fragen: Halt, was heisst das? Was will Martin hier sagen? Und wenn es nicht klar ist, dann fragt einen eurer Kameraden oder eine Kameradin, und wenn er oder sie es auch nicht wissen, kommt zu mir, denn in dieser Zusammenfassung hat jeder Satz eine Bedeutung, und diese Bedeutung müsst ihr herausarbeiten."
Wir haben in dem Kurs viel von Polaritäten gesprochen, und ich habe zu zeigen versucht, dass es im Leben selten um ein entweder oder, sondern meist um ein sowohl als auch geht. Heute haben wir also klare Führung und Strenge erlebt. Präzision war gefragt und es gab sogar richtige und falsche Antworten. Das ist der Gegenpol zu den Debatten, die wir sonst führen, Debatten, in denen ich kaum von falsch und richtig spreche, sondern nur immer zum Weiterdenken und Weiterfragen anrege. Es könnte so sein, es könnte aber auch anders sein ... Es macht Spass, mit dieser Gruppe zu arbeiten. Es macht mir Spass, aber ob es den StudentInnen wirklich etwas bringt? Was ich vermitteln will mag wichtig sein, aber kommt es an? Kann es überhaupt "ankommen". - Ich zweifle, doch vorläufig zweifle ich lustvoll und lebenddig.
Lustvolle Zweifel, das war gestern! Seit dem Aufwachen heute früh versprüre ich nur eine grosse graue Unlust. Draussen auf der Strasse das übliche auf und ab vieler menschen. Zwischendurch das Geräusch eines vorbeifahrenden Motorradtaxis oder das Meckern einer Ziege. Über meinem Kopf Füssescharren und Stimmengewirr. Hie und da lautes rufen oder Lachen oder Klopfen. Um acht geht da oben die Schule los. Während der Woche versammelt sich zur selben Zeit im "Auditorium", in dem ich nachmittags meine Kurse gebe, der Kindergarten, doch da heute Samstag ist, ist's aus der Richtung ruhig.
Ich stehe auf und gehe die fünf Schritte auf's Clo. Ein resignierter Versuch bestätigt: wieder kein fliessend Wasser. Ich knie vor der Duschwanne und wasche mich mit dem Wasser aus einem grossen, allzeit bereiten Bottich. Dann rasiere ich mich. Ich bin schliesslich wer und darf nicht allzu vergammelt rumlaufen. Danach sitze ich in meinem Zimmer und warte auf das warme Wassr für meinen Morgenkaffee. Gäb's hier Strom, so hätte ich mir längst einen Tauchsieder gekauft, sodass ich mir wenigstens mein Warmwasser selber machen kann, aber so sitze ich eben da und warte. Ich weiss nicht einmal, wo sie hier kochen. Vor zehn Tagen zeigte Floris Frau Asmita mirr zwar die Küche dder UPP, doch wegen der Bauerei wird hier ständig alles verändert, und die Küche ist immer verschlossen. Das meiste Essen kocht Madame Pasteur ohnehin nicht hier, sondern bei sich zuhause, etwa 100 Meter die Strasse runter.
Ich sitze und höre mir im Radio an, was die Welt zum Rücktritt Mubaraks sagt. Asmita kommt vorbei. Ein apathischer, schlaffer Händedruck und die Frage, wie meine Nacht war ... Ich weiss nicht, ob sie ein wenig plaudern will, ob sie überhaupt mehr von mir wissen möchte ... Ich reagiere freundlich apathisch wie sie. Fünf Minuten später kommt Flory. Auch er fragt danach, wie meine Nacht war. Ich fühle mich energielos. Wo bleibt das heisse Wasser. Ich brauche einen Kaffee! Bitte bitte! Weshalb bin ich hier so eingesperrt und hilflos. Flory fragt nach dem Antivirprogramm, denn der PC des Büros ist völlig verwurmt, und ich habe noch eine Antivirversion auf meinem Stick. endlich bringt Asmina den Termoskrug mit warmem Wasser. Ich rühre meinen Morgenkaffee an. Vor einer Woche habe ich herausgefunden, dass es doch echten, richtigen Kaffee gibt! Dabei habe ich Robert und Flory sicher zehn mal danach gefragt, und sie haben immer nur von Nesskaffee gesprochen ... Überhaupt die Verständigung über das Essen! Ich wollte eigentlich das essen, was die Menschen hier normalerweise essen. Einmal habe ich geglaubt, mein Wunsch sei endlich angekommen, aber wenn er je angekommen ist, so isst er doch ziemlich wirkungslos geblieben. Ich werde hier weiterhin in ganz unrealistischer Weise gefüttert, weil man einem Europäer die hiesige Lebensweise nicht zutrauen kann ... Ich bin heimatlos hier, eine Respektsperson in einem kleinen Zimmer. Seit Marokko, wo mein Daisyplayerseinen Geist aufgegeben hat, habe ich nichts mehr zu lesen, und mein Netbook hat andauernd zu wenig Strom. Ich überbrücke die leeren Stunden mit den Nachrichtensendungen von BBC World Service oder von Radio France International.
Mein Bewegungsradius endet an der Schwelle zum Vorplatz des Hauses und an seiner Hintertür. Vor dem Haus wird gebaut. Die drei grossen Löcher für die Jauchegrube sind inzwischen zwar zu, aber sonst steht und liegt immer viel herum; dazu hockt immer irgendwer irgendwo. Es ist mir alles zu unübersichtlich. Die Strasse hinterm Haus, auf die hinaus mein Zimmer geht, ist schmaler, doch ist sie mir auch nicht ganz geheuer. Ich bin ängstlich. Es ist ein Teufelskreis. ich muss mich einmal hinaus wagen, sonst komme ich hier nie an!
Die Arbeit ist auf gutem Weg, doch ein richtiges Leben habe ich hier nicht. Keine Freunde, keine wirklichen Gesprächspartner. Sicher, mit Flory lässt sich gut reden, doch wenn wir redn, dann immer über die UPP und ihre Möglichkeiten. ich vermisse die direkte und persönliche Beziehung, die ich zu Ousmane und Sy Abdoullaye und zu Moussa hatte. Moussa! Ja, ihn will ich heute endlich einmal anrufen. Seitt ich hier bin hatte ich ihn nur einmal kurz am Telefon, um ihm zu sagen, dass ich gut angekommen bin. Auch sonst würde ich gerne mehr telefonieren: Mit Vicky in indien und mit den Freunden und der Familie zu hause, doch auch in der Richtung ist hier alles schwierig und zäh.
Bedes Witwen, die Wurstfabrik der Bllinden und der Trraum von den weissen Knaben
Um neun Uhr kommt Bede, einer meiner Studenten. Er wollte mmich sprechen. Er setzt sich und kommt gleich zur Sache. Er arbeite seit zweieinhalb Jahren mit einer Gruppe von etwa 40 Frauen, viele von ihnen Witwen. Er versucht, ihnen in ihrem Überlebenskampf zu helfen. Früher hätten die Frauen auf dem Feld gearbeitet, doch sei dies für die meisten von ihnen zu anstrengend. Jetzt hätten sie mit der Produktion von Würsten begonnen. Bede spricht leise. Er sitzt vornübergebeugt da. Er ist 33 Jahre alt und hat eine zweimonate alte Tochter. Auch er habe früher auf dem Feld gearbeitet. Doch sei er dazu seit einiger Zeit nicht mehr fähig. Er hat offenbar irgendwelche chronischen Magenprobleme. Jetzt verdient er hie und da etwas Geld als Maler und Künstler. Künstler? ich frage nicht weiter nach. Sein Vater hat zwei Frauen; Bede ist der älteste oder zweitälteste von 15 Geschwistern. Der Vater sei alt und könne nicht mehr viel tun. Wir sprechen wieder über seine Arbeit mit den Frauen. Um voranzukommen bräuchten sie eine wurstmaschine. Bis jetzt würden sie hie und da eine mieten, doch sei das auf dauer keine Lösung. Eine gute Wurstmaschine kostet 150 Dollar. ob ich ihm einen Rat habe ... Bede spricht immer leiser ... Ich mache mein obligates inneres Spiel: soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht ... Oft versuche ich mit meinen Ratsuchern zu überlegen, wo man Geld oder Unterstützung finden könne, doch Bede sitzt da, weil er auf mich hofft. Man kann sagen, er macht es sich einfach, doch für komplizierte und langwierige Verhandlungen hat er keine Kraft mehr. Er sagt, dass NGOs in Uvira sehr stark von ethnischen Strukturen geprägt seien. Wenn man nicht dem richtigen Stamm angehört, so hat man keine Chance. Es gäbe einige Offizielle in der Stadt, die evtl. helfen würden. Nicht mit öffentlichen Geldern, so was gäbe es in uvira nicht, aber mit ihrem eigenen Geld. In mir geht das Spiel weiter: soll ich, soll ich nicht ... Die Vernunft sagt nein, denn 1. kenne ich Bede nicht, 2. weiss ich nicht, wie real und sinnvoll sein Projekt ist und 3. kann ich unmöglich allen, die an meine Türe klopfen, helfen ... Es sind gute Gründe, sehr Gute sogar! Sie helfen uns, schön auf unseren Geldhaufen sitzen zu bleiben und die andern sich selber zu überlassen. Ich verschwinde kurz auf's Clo, und fummle hundert Dollar aus meinem Gürtel. Es ist alles etwas lächerlich. Der Reiche, der sich grossmütig entschlossen hat zu geben und sich dann schamhaft ins Clo einsperrt, damit niemand sieht, wo er seine Reichtümer versteckt hält ... Ich gebe Bede die 150 Dollar. Dabei errzähle ich ihm kurz von Moése, einem blinden jungen Mann, den ich in der Blindenschule kennengelernt habe. Er hat mir von seinem Traum erzählt, sich als Wurstmacher durchzubringen. Nur natürlich bräuchte auch er die nötige Ausrüstung. Er hat mir alles, was er für seine kleine Wursterei braucht, auf Punktschrift aufgeschrieben. Das Blatt liegt auf meinem Schreibtisch ... ich frage Bede, ob er versuchen könne, Moése in die Arbeit seiner Gruppe einzubeziehen. Er sagt sofort ja, und wir vereinbaren, dass er heute nachmittag in die Blindenschule kommt, um mit Moése zu sprechen.
ich bin ab halb drei ohnehin dort, weil Frau Lundimo mich über die Arbeit des provisorischen Kommittees des Blindenverbandes von Uvira informieren will. Wir haben dieses Kommittee anlässlich des Treffens vom vergangenen Dienstag ins Leben gerufen. Ihm gehören neben Frau Lundimo, der blinden Lehrerin und ehemaligen Hühner- und Ziegenhalterin, noch zwei blinde Männer an, die am dienstag im Publikum waren. Am nächsten Samstag, dem 19. Februar, will man sich erneut treffen, um ein definitives Kommittee zu wählen. Bis dann will man noch breiter einladen. Die Vorbereitung und Leitung dieses zweiten Treffens liegt in den Händen des provisorischen Kommittees, damit von Anfang an klar wird, dass es hier um eine Selbsthilfegruppe geht und dass man sich nicht auf andere verlassen soll und kann!
Als ich in der Blindenschule ankomme, ist Bede noch nicht da. Die andern begrüssen mich freudig. Frau Lundimo erzählt mir, was das inzwischen aus vier blinden Mitgliedern bestehende Kommittee für den kommenden samstag vorgesehen hat. Dann fragt Moése was ich über seinen Brief denke. Ich erzähle von meiner Idee, Moése und evtl. weitere blinde Wurstmacher in das Projekt von Bede zu integrieren. Im Augenblick, in dem ich seinen Namen nenne, ghet ein Stönen durch die Gruppe. Nein. Mit Bede, das gehe nie. Kipousssa sagt: "Il mange l'argent". Und Moése ist prinzipiell dagegen, mit Sehenden zu arbeiten. Er fürchtet in so einer Gruppe sofort an den Rand gedrängt und übergangen zu werden. Das Misstrauen gegen Bede bleibt bestehen. Doch scheinnt auch Moése zu begreifen, dass er einer Zusammenarbeit mit Sehenden nicht immer ausweichen kann, wobei man natürlich aufpassen muss, dass das, was er befürchtet, nicht geschieht. Er ist beruhigt als ich sage, dass ein gemeinsames Projekt zB vom Kommittee des neuen Blindenverbandes begleitet und beaufsichtigt werden könnte.
Als Bede eintrifft ist die Stimmung gespannt. Ich höre noch die ablehnenden Äusserungen von eben. Hab ich heute früh doch auf einen lahmen Gaul oder gar ein falsches Pferd gesetzt? Ich will Bede nicht so schnell abschreiben und sage ihm deshalb, dass ich an eine Zusammenarbeit gedacht habe, dass man von der Idee hier aber nicht begeistert sei. Allmählich kommt ein Gespräch in Gang. Ich höre zu. Man lacht. Hie und da fliesst ein französisches Wort den suahilischen Diskussionsfluss hinunter. Am Ende haben sie sich darauf geeinigt, dass das Kommittee die Sache noch einmal gründlich überlegen und am kommenden Samstag mit Bede reden werde. Ich habe klar gemacht, dass ich keine Lust habe, zwei kleine Unternehmen zu unterstützen, die sich gegenseitig bekriegen. Wenn es menschlich und sachlich möglich sei, fände ich es viel sinnvoller, wenn sie sich zusammentun und ihre Ressourcen gemeinsam nutzen würden. Man findet das auch, doch wird daraus wohl nichts, denn das Misstrauen gegenüber Bede ist noch immer da. "Er ist ein guter Arbeiter", sagt Kipoussa, als wir zurück in der UPP sind, "doch ein Projekt leiten, das kann er nicht. Da fliesst das Geld irgendwo hin und aus dem Projekt wird nie etwas."
Ich bin etwas müde und mutlos. Es ist nicht mein Tag! Am Ende unserer Sitzung habe ich mit dem Gardian der Blindenschule noch eine Viertelstunde über seinen Wunsch gesprochen, mit zwei oder drei weissen Kindern in Kontakt zu kommen, um hier in der Schule weniger einsam zu sein. Mit zwei oder drei weissen Kindern? Ja, er suche nach Austausch und nach Freundschaft. Er sei 25 und habe das Diplom, also eine Art Hochschulreife. Die Kinder, ja die könnten 10 oder 12 Jahre alt sein. Weisse dächten einfach anders und seien klüger. Hier finde er niemanden, mit dem er sich austauschen könne, aber dort, in Europa ... Was er sagt klingt für mich völlig schräg; ich frage nach, dann versuche ich ihm klar zu machen, dass er den Kontakt mit Erwachsenen Menschen suchen muss, und dass dies heute am einfachsten übers Internet gehe. Es sei zudem auch der billigere Weg als sich Briefe zu schreiben oder zu telefonieren. Es leuchtet ihm alles ein, aber ich denke, er wird weiter von seinen weissen Kindern träumen, und ich grüble weiter darüber nach, was er wohl eigentlich will.
Auf dem Rückweg in die UPP wollten wir noch Kaffee kaufen, doch sind wir schliesslich mit leeren Händen hier angekommen. Der Congo ist kein Land für Kaffeetrinker. Kipoussa wollte zwar noch einmal kommen und mir welchen bringen, doch er scheint kein Glück zu haben. Ich bin k.o.. Was soll ich hier im Congo. Was soll ich in dieser Misere, und kein Kaffee zur Aufhellung der Stimmung!
Padri, die kongolesische Sekundarschule und die Frage, wem unser Geld eigentlich gehört
Um halb acht bringt Madame Pasteur mir einen Teller voll Essen. Um acht kommt Padri, der 50 Dollar braucht, um das elfte Schuljahr fertig machen zu können. Wir sitzen eine Stunde in meinem Zimmer; es ist dunkel. Padri erzählt mir seine Geschichte. Bis jetzt haben seine beiden älteren Brüder das Schulgeld für ihn aufgetrieben, doch seit ein paar Monaten haben sie keine Arbeit mehr, sodass er seit Weihnachten nicht mehr in die Schule konnte. "Ich hab's ein paar mal probiert, aber sie jagen mich heim. Nein, es ist keine Privatschule, aber die Lehrer sagen, der Staat bezahlt ihnen keinen Lohn, sodass sie auf unser Geld angewiesen seien. Ich habe versucht, mit dem Aufseher zu sprechen, aber er sagt nur, "Was denkst du, sollen unsere Lehrer verhungern. Die Schule ist nicht's für Arme!" Ich habe auch versucht, zu schwindeln, habe gesagt, ich bringe das Geld nächsten Mittwoch, doch da wurde der Aufseher wütend und hat mich geohrfeigt und fortgejagt." Padris Vater ist vor fünf Jahren gestorben. Er habe dafür gesorgt, dass seine Kinder alle in die Schule gehen. Aber seit er tot sei, sei es finanziell oft knapp gewesen. Und jetzt könne er überhaupt nicht hin. Er sei den ganzen Tag zuhause oder gehe zu den Blinden rüber, um nicht allein zu sein. Nein, Frau Lundimo habe ihn nicht ermutigt, doch einmal mit mir zu sprechen. Das sei sein eigener Entschluss ...
Ich denke an die 150 Dollar, die ich am morgen weichherzig und dumm in den Sand gesetzt habe. Zugleich denke ich daran, mit welcher Selbstverständlichkeit ich in der Schweiz für eine kleine Bahnreise oder ein Abendessen in einer Beiz 50 oder 80 Franken bezahle. Einfach so, ohne gross nachzudenken. Ich weiss nicht, was mich davon abhält, hier genauso grosszügig mit meinem Geld umzugehen! Padri braucht doch Hilfe! Was soll das Zögern, und wenn er mich bescheisst! Sei's drum. Sicher kann ich in diesen Dingen nie sein. Natürlich, mein Gefühl kann mich täuschen, aber ich habe nichts anderes als mein Gefühl, um hier zu entscheiden. Soll ich Papiere verlangen und Referenzen oder eine Kommission zur Abklärung solcher Fälle etablieren? Das würde vor Betrug nicht schützen, aber es würde Padri zeigen, dass wir ihm nicht vertrauen. Es würde die Mauer des Mistrauens zwischen denen, die haben, und denen, die nicht haben, erhöhen.
Ich ärgere mich über mich und über die Situation. Padri ist 20 Jahre alt, er spricht leise und schüchtern. Er könnte 15 oder 16 sein. Er hat in der Blindenschule ein Geographie- und ein Geschichtsbuch gefunden. "Ja, die habe ich gelesen und alles notiert. Wenn ich mehr Bücher hätte, könnte ich auch ohne Lehrer viel lernen, aber wir haben keine Bücher. In der Schule gibt's keine Bücher. Wir gehen hin und schreiben alles auf, was die Lehrer sagen. Das sind die Bücher. Was am meisten fehlt ist ein Larousse." Ich frage nach: etwa 10 Prozent der Schüler besitzen ein paar Schulbücher. Für den Rest sind sie zu teuer. Und der Larousse? nein, kein Wörterbuch, sondern ein Lexikon, in dem man sich über die Dinge der Welt schlau machen kann ... wenn man eines besitzt!
Ich sage ihm, dass ich helfen würde. Der Pasteur, der hier als eine Art Factotum für alles zuständig ist und wie ein Geist von morgens bis Abends ums haus schleicht, versucht einen Geldwechsler zu finden, der meine hundert Dollar-Note in kleinere Scheine wechseln kann, doch ist um diese zeit nichts mehr zu machen. Padri wird morgen Abend noch einmal kommen und die fünfzig Dollar abholen. Fünfzig Dollar für diesen zufälligen Jungen. Dabei gibt's hier tausende von jungen Menschen wie er, tausende, denen man helfen müsste, tausende, die nicht vorankommen im Leben. Und daneben - vielleicht noch schlimmer - die Alten oder die Behinderten, die nur noch als Bettler existieren können ... Man müsste mit einem grossen Hilfsprogramm hier sein, so wie die Quäker nach dem ersten Weltkrieg in Berlin und anderen hungernden Städten in Deutschland ... Essen, Geld für die Schule, Geld für notwendigste Medizin, für Berufsausbildung oder für ein paar Werkzeuge, um sich damit den Lebensunterhalt zu verdienen. Man müsste grosszügig geben, denn wer sind wir, dass wir immer argwöhnisch nach eventuellem Missbrauch fragen. Natürlich gibt es "Missbrauch". Natürlich wird Geld abgezweigt, um nötiges Essen zu kaufen. Vielleicht geht auch einmal jemand ins Kino oder kauft sich ein Secondhand T-Shirt! statt alles, wie vereinbart, für die Schule auszugeben! Aber wer sind wir, über diesem "Missbrauch" zu wachen, als ob man uns das letzte Stück Brot geklaut hätte! Wir sagen, "aber es ist immerhin mein Geld". Dieses Argument berechtigt uns darüber zu entscheiden, wem wir untter welchen Bedingungen wie viel geben. Es berechtigt uns auch, nichts zu geben, weil wir im Moment gerade am Hausumbauen sind oder unser Geld für ein neues Auto oder eine Keniareise brauchen. Es ist unser Geld! Wir sind niemandem Rechenschaft darüber schuldig, was wir damit tun.
Die Behauptung, dass unser Geld unser Geld ist, ist die schärfste Waffe in unserem Abwehrkampf gegen die Ansprüche der Habenichtse. Sie nimmt diesen das Recht zu fragen, auf welche Weise wir denn zu unserem Geld gekommen sind, und auf welche Weise wir sicher zu stellen versuchen, dass wir auch künftig mehr haben als sie.
Von Schüler-Soldaten, von biologischem Landbau und Lünchjustiz. Meine Sonntage mit Babu

Kühe am Grasen
Babu ist der vierte meiner helfer. Am vergangenen Sonntag haben wir einen Ausflug in die nahen Berge gemacht. Wir waren zwei oder drei Stunden unterwegs. Ausserhalb Uviras, wo das Terrain anzusteigen beginnt, gibt es nur noch Wege und Pfade. Die Hügel sind dicht bewachsen. Hohes Gras, Sträucher und Bäume, und dazwischen kleine Manjokfelder. Babu zeigt und erklärt. Etwas weiter oben kkommen wir in ein Stück Wald. Es ist eine gesetzlich geschützte Zone. Insgesamt geht es dem Wald in den Hügeln allerdings nicht gut. In den Kriegsjahren, d.h. in den Jahren 1996 bis 2000, wurde in diesen Bergen gekämpft, und die Bevölkerung von Uvira hat sich teils wochenlang hier oben versteckt. Damals wurden viele Bäume geffällt, um den bedarf an Brennholz zu decken oder um das Terrain besser verteidigen zu können.
Während wir im Schatten eines dicken baumes sitzen und uns ausruhen erzählt Babu nebenher, dass er während dieser Zeit oft hier in den Hügeln gewesen sei. "Ich war ein Mai-Mai-Soldat. ich hatte kein Gewehr, aber ich habe bei der Informationsübermittlung geholfen. Normalerweise war ich in der Schule wie alle anderen. Niemand wusste davon, dass ich zu den mai-Mai gehöre. Die Führer in Uvira hätten das nicht toleriert, denn wenn man uns Schüler verdächtigt hätte, politisch aktiv zu sein, so hätten die Soldaten uns nicht mehr geschont. So war die Schuluniform in den ganzen Jahren ein Schutz. Man sagte: Lasst sie in Ruhe. Es sind nur Schüler! Aber ich wollte nicht einfach zuschauen, während unsere Gegend von fremden Soldaten tyrannisiert wurde. Also hab ich mich bei den Mai-Mai gemeldet. Ich war damals 15 oder 16, und wenn wieder irgend welche Soldaten auftauchten, dann bin ich Abends rauf in die Berge, um sie zu beobachten und die anderen zu informieren, wieviel sich wo aufhalten und was sie vor haben." Babu ist stolz. "Weisst du, uns Mai-Mai können die Kugeln der Feinde nichts anhaben; nicht einmal eine Granate. Wenn sie kommt rufen wir "mai", d.h. Wasser!, und die Kugel oder die Granate prallt einfach an uns ab." Die Mai-Mai waren junge Männer, die wie Babu nicht tatenlos zuschauen wollten, wie ihre Heimat von fremden Soldaten verwüstet, ihre Frauen vergewaltigt und ihre Dörfer niedergebrannt wurden. Zu Beginn des Krieges mit Rwanda standen sie bei der lokalen Bevölkerung in hohem Ansehen. Aber mit der Zeit geriet die Bewegung immer mehr ausser Kontrolle und wurde in manchen Gegenden selber zur Landplage. Ich sitze neben Babu und höre aufmerksam zu. Jetzt erzählt er mir dies alles. Als ich in der Englischstunde zwei Tage zuvor darüber diskutierren wollte, wie die einzelnen den Krieg erlebt haben, wollte niemand erzählen, auch Babu nicht. Ich merke einmal mehr, wie wenig Ahnung ich davon habe, wo ich hier eigentlich gelandet bin, und was um mich herum los ist.
Gestern waren wir wieder unterwegs. Diesmal ging's per Motorrad nach Kiliba, einem ansehnlichen Dorf etwa 15 km von Uvira entfernt. Babu wollte mir die dortigen Reisfelder und eine Reismühle zeigen. Wie immer, wenn ich mich ein wenig aus der Stadt hinausbewege, bin ich auch diesmal von der Fruchtbarkeit und dem Pflanzenreichtum der Gegend begeistert. Auf dem Rückweg von den Felldern kommen wir an der Kirche der Pfingstgemeinde von Kiliba vorüber; man fragt Babu über den blinden Weissen aus, und dann soll ich den Pfarrer begrüssen. "Se saluer", das ist hier eine grosse Sache. Manchmal geht es bloss um eine Geste des Respekts. manchmal kommt man dabei auch miteinander ins Gespräch. Das ist auch jetzt der Fall. Wir sind offenbar mitten in eine Sitzung des Kirchenrates geplatzt. Ich erkläre kurz, was mich nach Afrika geführt hat, was ich in Uvira tue und weshalb ich heute nach Kiliba gekommen bin. Dann sage ich, wie beeindruckt ich von dem Land um ihr Dorf und von dem guten Zustand ihrer Felder sei. Das führt zu einer vielleicht halbstündigen Debatte über die Situation der Bauern in Kiliba. Die Männer klagen rundum: "Ja, das Land ist fruchtbar, aber das Leben hier ist hart. Wir arbeiten viel und die Arbeit ist oft sehr anstrengend, und doch kommen wwir zu nichts. Die Reispreise sind so niedrig, dass wir mit dem Verkauf von Reis nichts verdienen können. Dazu fehlt es uns an Geld für Unkraut- und Insektenvertilgungsmittel und für bessere Maschinen und Saatgut." Ich werde hellhörig und frage, ob sie schon einmal von biologischem Landbau und von natürlichen Arten der Unkraut- und Insektenbekämpfung gehört haben. Jemand fordert mich auf, zu erklären, und ich beschreibe die in Europa geführte Debatte zwischen den Vertretern einer auf grosse Maschinen, chemische Düngemittel und Insektizide und ähnliche Dinge setzenden Landwirtschaft und einer Landwirtschaft, die den Schädlingen beispielsweise durch den Anbau verschiedener Pflanzen in einem Feld zu begegnen versucht. Ich spreche vom Kapitalbedarf der industriellen Landwirtschaft und von den Interessen der Grosskonzerne an dieser Art von Agrobusiness, von der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen und den Geschäftsinteressen der Saatgut- und Agrochemiefirmen und von der Alternative, dem biologischen und organischen Anbau und den sich überall entwickelnden Genossenschaften, die ihre Produkte unter dem Namen Fair Trade verkaufen. Ich höre mir selbst mit einigem Misstrauen zu, denn ich bin kein Experte in Sachen Landwirtschaft und halte doch eine solche Rede. Immerhin, einige der Zuhörer scheinen interessiert: Kann man wirklich Insekten dadurch bekämpfen, dass man andere Tiere in der Nähe anzusiedeln versucht? Und wie ist das genau mit den Preisen, die man für Fair Trade Produkte erzielen kann ... Dann kommt bald die Frage und Bitte, ob ich nicht etwas für sie tun könne, wenn ich wieder in der Schweiz bin. Vielleicht Geld, vielleicht ... Ich wehre ab. Das einzige was mir in den Sinn komme sei eine gute Freundin, eine Frau, die sich seit Jahren mit der Frage einer anderen Landwirtschaft befasst und viele Projekte in Indien, Afrika und Europa besucht habe. Ihr würde ich schreiben, und sie fragen, ob sie nicht einmal nach Uvira und Kiliba kommen und sich dieses wunderbare Land ansehen und mit den Bauern sprechen könne. Ja, ja, das solle ich tun; sie müssten einmal über diese Dinge reden, wenn sie weiterkommen wollten. Wieder einmal werden Email-Adressen ausgetauscht. Ich weiss nicht, ob ich nicht völlig an der Situation der Bauern vorbeigeredet habe, aber ich weiss, dass ich gerne dabei wäre, wenn es hier eine Diskussion über verschiedene Möglichkeiten landwirtschaftlicher Entwicklung gäbe!
Robert, unser Vize-Rektor und Chef der Administration, den ich zur Vervollständigung meines bildes ein paar Tage später zum Thema befrage, kennt zwar einige lokale Initiativen, die den Bauern vor allem durch die Vergabe von Saatgut helfen, aber von dem, was ich ihm über integrierte Landwirtschaft und Agrobusiness, lokale und frei zugängliche oder global standartisierte und patentierte Reis- oder Maissorten, von Fair Trade etc. etc. erzähle, scheint er nichts zu wissen. Doch allmählich versteht er und sein Interesse wird wach: "Doch, doch, man müsste in der Richtung mehr wissen, denn hier überlebt man einfach von Jahr zu Jahr. An die Weiterentwicklung unserer Landwirtschaft und an die Folgen für die hiesige Natur und die Menschen denken wir nicht. Wir sind zu sehr mit der Bewälltigung des Alltags beschäftigt. Aber wenn deine Bekannte hier einen Workshop zu dem Thema leiten würde, das wäre höchst interessant." - Tatsächlich, das könnte sehr interessant und wertvoll sein! Ich werde an Floriane schreiben. Wer weiss, vielleicht ist sie ohnehin wieder einmal in Afrika unterwegs!
Auf dem Rückweg von Kiliba will ich noch Kafee kaufen. Die paar Laden hier im quartier haben keinen mehr. Also fahren wir ins Zentrum der Stadt, doch dort sind alle Geschäfte geschlossen. Babu ist ganz unglücklich, denn er will doch helfen, dann sagt er: "Aha, es ist wahrscheinlich wegen der beiden Menschen, die man heute früh verbrannt hat." Ich denke, mich laust der Affe! Ich beuge mich vor und frage ihn: "Brûlé? Tu as vraiementt dit brûlé?" "Ja, ja, verbrannt. Benzin über sie geschüttet und ein Zündholz rangehalten ...".
Zurück in der UPP erzählt er, dass jemand in der Nacht von Samstag auf Sonntag umgebracht worden sei, ein reicher und beliebter Bürger, bei dem man eingebrochen habe. Da die Polizei nichts zu unternehmen schien, hätten einige junge Männer beschlossen, die Sache in ihre eigenen Hände zu nehmen und die Täter zu bestrafen. Zwei Tage später erzählt mir ein anderer meiner Studenten, dass an dem Sonntag insgesamt fünf Männer umgebracht worden seien, dass die eigentlichen Täter bis jetzt jedoch nicht gefunden wurden. Die Geschichte sorgt für einigen Wirbel, aber wirklich alarmiert scheint hier niemand. Meine StudentInnen erklären mir am Montag im Psychologiekurs, dass $Lorenz Kabila, der 2001 ermordete Vater des heutigen Präsidenten der demokratischen Republik Kongo, angesichts des Chaos in seinem Land ende der 1990erjahre ein Gesetz erlassen habe, welches die Bürger und Bürgerinnen des Kongo aufforderte, den Kampf gegen das Verbrechen in ihre eigenen Hände zu nehmen. Obwohl dieses Gesetz ein paar Jahre später von Kabilas Sohn als ungültig erklärt und entsprechende Handlungen seither wieder verboten seien, habe man sich damals daran gewöhnt, dass man in seiner Umgebung selber für Ordnung sorgen müsse und dürfe. Zwischenfälle wie der gestrige seien zwarr selten, aber sie kämen vor, und sie seien auch verständlich, denn selbst wenn die Polizei zur Stelle gewesen und die Täter gefasst hätte, so hätte man sie nach zwei Stunden oder zwei Tagen wieder freigelassen. Die Polizei werde so schlecht bezahlt, dass sie jede Gelegenheit, ein paar Dollar extra zu verdienen, benützen, und dasselbe gelte für die Gerichte. Es sei in Uvira also völlig sinnlos, auf die Polizei und die Gerichte zu setzen.
Wir diskutieren lange, was man unter diesen Umständen tun könne. Obwohl die meisten den Vorfall vom Sonntag verurteilen, ist das Verständnis für die Reaktion der aufgebrachten Menge gross, und einige meiner Studierenden bleiben bis zum Ende der Diskussion bei ihrer Auffassung, dass man Verbrecher nicht mit Samthandschuhen anfassen dürfe, sondern dass man ihnen zeigen müsse, dass für sie kein Platz in der Gesellschaft sei. Dass bei dieser Demonstration der Härte fünf unschuldige Menschen umgebracht und die eigentlichen Täter noch immer nicht