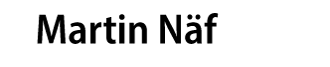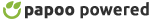„Lauf, Bello, lauf". Erinnerungen an die ersten Schuljahre
Die „Roten" und die „Blauen" waren auch die beiden Abteilungen unserer Klasse. Ich gehörte zu den „Roten". Manchmal hatten wir ohne die „Blauen" Schule. Weshalb das so war und was die „Blauen" in der Zeit taten, wusste ich nicht. Es war auch egal, denn um all dieses kümmerten sich die Erwachsenen. Sie stellten die Spielregeln auf, sagten was man am Nachmittag mitzubringen habe, welches Heft jetzt hervorgenommen werden sollte, wann und wo man die Pausenmilch trinken durfte und vieles mehr.
Jetzt wo ich an die Pausenmilch denke wird mir klar, dass es damals auch hie und da Herbst oder Winter gewesen sein muss, denn die Pausenmilch ist für mich mit Kälte verbunden, und manchmal lag Laub, wenn wir Fussball spielten, und dann gab es Zeiten, während welchen wir ganze Vor- und Nachmittage auf der Kunsteisbahn verbrachten, wo uns unser Lehrer in die Geheimnisse des Schlittschuhlaufens einführte, eine Aktivität, die vor allem darin bestand, das er uns beim Anpassen und beim fachmännischen Festschrauben der ausziehbaren „Schrubedämpferli" half, während die wenigen stolzen Besitzer echter Schlittschuhe in irgend einer Ecke des Umziehraums auf das Ende dieser aufwendigen Operation warteten.
Die Aufführung von Max und Moritz, bei welcher ich im Chor mitwirkte, muss ebenfalls im Winter stattgefunden haben, denn als die offizielle Vorstellung für die Eltern begann war es draussen stock dunkel und bitter kalt. Diese Aufführung – ein Joint Venture mit der Klasse von Herrn Lörer, dem Lehrer der Parallelklasse – gehörte zu den Höhepunkten des schulischen Programms jener vier friedlichen Jahre. Zu diesen Höhepunkten gehörten für mich auch die ein oder zweimal pro Jahr statt findenden ganztägigen Ausflüge auf irgend eine Burgruine der Umgebung, wo wir Feuer machten, Würstchen brieten und spielten bis es Zeit war zu gehen. Am Abend vorher musste der Rucksack gepackt werden: Ein oder zwei Servola, ein Apfel, ein Stück Brot und manchmal vielleicht auch noch ein paar Kekse oder gar ein Mars! Dazu Tee in einer roten oder gelben einliterflasche aus billigem Plastik mit Schraubverschluss und aufstülpbarem Becher sowie ein Taschenmesser und ein paar andere nützliche Dinge.
Mit dem, wozu die Schule erfunden wurde, hatten diese Anlässe nur am rande zu tun. Zumindest aus offizieller Sicht waren das Nebengeschäfte, genauso wie das stundenlange Murmelspielen und Gummitwisten während der Pausen und die Ringkämpfe hinten im Schulzimmer während der drei oder fünf Minuten, die unser Lehrer jeweils zu spät kam, oder das selbstvergessene Kastaniensammeln in dem an meinem Nach hauseweg gelegenen Hinterhof. Es sind Dinge, die damals und heute nicht „zählen", da sie nichts mit Lesen und Rechnen, Religion oder Heimatkunde und den übrigen Schulfächern zu tun haben , und doch sind es die Dinge, die mir zu allererst in den Sinn kommen, wenn ich an meine Primarschulzeit denke.
Was das Lesen und das Schreiben angeht, so erinnere ich mich noch an einige der Bildtafeln, mit denen Herr Brenner, unser brummlig distanzierter, aus meiner Sicht jedoch gerechter Lehrer, uns in die Welt der Buchstaben einführte: Ein auf einem Böckchen sitzender Affe, der sich mit seinem Schwanz an einem der Beine des Böckchens festklammerte, stand für das grosse A. Ein im Bett liegender, mit einem dicken Federbett zugedeckter Bäcker stand für das B. Nach und nach hing eine ganze Reihe solcher Bilder neben der Türe und auch die Blätter in unserem Leseordner nahmen ständig zu: Anneli hat den Ball. Wo ist der Ball. Bello hat den Ball. Bello und Anneli haben den Ball. Anneli und Hansli haben den Ball. Wo ist der Ball? ... Es war nicht besonders aufregend, aber wir waren doch stolz, wenn wir immer wieder mal ein neues Blatt in unser Ringheft legen durften, nachdem wir die Löcher vorher fein säuberlich mit den extra zu diesem Zweck herumgereichten Papierringchen verstärkt hatten. „Lauf Bello, lauf, hohl den Ball. Wo ist der Ball, Bello! Wo ist Anneli? Lauf Anneli, lauf. Bello hat den Ball." – Die Papierringchen waren in einer kleinen Schachtel und mussten auf einer Seite mit der Zunge angefeuchtet werden. Dabei musste man aufpassen, dass sie nicht zu nass wurden, denn dann blieben sie gerne an den eigenen Fingern oder irgendwo sonst kleben und liessen sich nur schwer zu der für sie bestimmten Stelle auf dem Papier bringen.
Beim Schreiben mussten wir besonders darauf achten, dass die Buchstaben schön auf der Linie sassen und nicht zu klein und nicht zu gross waren. Zuhause durfte ich manchmal den Füller meiner Mutter benutzen. Er war dick und hatte eine auffallend hell blaue Tinte. In der Schule schrieben wir noch mit richtigen Federn – hölzerne Griffe mit aufsteckbaren Metallkielen, die jeweils nach ein oder zwei Zeilen ins Tintenfass getunkt und danach meist noch etwas abgeklopft werden mussten, damit es keine Kleckse gab.
Anfänglich faszinierte mich das Schreiben weil ich da so genau hinsehen musste, doch allmählich verlor es seinen Reiz. Auch die Bildtafeln mit den Buchstaben gehörten irgendwann der Vergangenheit an. Ich konnte jetzt lesen: Henriette Bimmelbahn zum Beispiel, und das war gut. Mit dem Schreiben ging es ebenfalls voran, obwohl ich noch in der vierten Klasse grösste Mühe hatte, wenn es um die Richtung ging, in welcher das kleine d zeigen sollte oder wenn ich mit der Buchstabenfolge ch konfrontiert war. Ich sas jeweils lange da und dachte nach, bis ich mich mutig und mit fast traumwandlerischer Sicherheit einmal mehr für die falshce Löshcung entshcloss. Dieser Kampf hätte der Ausgangspunkt für ein Drama und eine Sonderschulkarriere werden können, doch irgendwie fügte sich alles zum Guten, und gerade rechtzeitig vor Beginn des Gymnasiums lagen die Schwierigkeiten mit dem kleinen d und dem unbegreiflichen ch – ch? oder hc oder ... - so ziemlich hinter mir.
Für Esther, eine Klassenkameradin, mit der ich im übrigen nie näher zu tun hatte, lief die Sache weniger rund: Ich erinnere mich daran, wie sie manchmal in der Klasse stand, und Herr Brenner sich bemühte, irgend etwas aus ihr hervorzulocken – das Resultat einer Rechnung vielleicht oder die Antwort auf eine andere Frage. Es kommt mir so vor, als ob Esther manchmal eine halbe Stunde da stand. Es war peinlich für alle und pädagogisch hat es offenbar nichts gebracht, denn eines Tages war Esther fort. Obschon ich Esther, wie gesagt, nicht näher gekannt habe, und wir in der Schule, so weit ich mich erinnere, auch nie über den Vorfall redeten, war mir ihr Verschwinden doch etwas unheimlich. Es schien irgendwie mit dem von meinem Vater lange vor jener Zeit gelegentlich beschworenen schwarzen Mann zu tun zu haben, der Kinder mit sich nimmt, wenn diese nicht brav sind. Der Vorfall mit Esther belehrte mich jedenfalls in subtiler Weise darüber, dass es gefährlich war, sich dem Schulbetrieb all zu sehr in den Weg zu stellen. Bereitwillig und flink zu antworten war offenbar eine Art Grundvoraussetzung für jeden schulischen Erfolg. Auch da ist die Schule mit der Zeit gegangen. Jetzt behält man die Menschen länger in der Klasse. Man hat Stützlehrerinnen und Stützlehrer und Stützlehrer, die die Lehrer stützen, aber am Schluss kommt es auf das gleiche heraus. Einige schaffen"s und andere versinken in der "Masse",
Was das Rechnen angeht, erinnere ich mich vor allem an strapaziöse Kopfrechenwettbewerbe, bei denen die Hälfte der Bänke verlassen dastand, weil ihre Besitzer und Besitzerinnen irgendwo im Schulzimmer standen und sich auf dem festgelegten Parcours Antwort für Antwort weiter voran arbeiteten, bis sie wieder an ihrem Platz angekommen waren. Es waren strapaziöse Wettbewerbe, denn ich gehörte meist zur Spitzengruppe und das bedeutete Aufregung und Stress. Schnell zu sein war das oberste Gebot, wenn ich meinen Platz in dieser Disziplin behalten wollte.
Auf welchem Weg ich meine Rechenkünste erworben habe, weiss ich nicht mehr. Ich erinnere mich vage daran, wie stolz wir jeweils waren, wenn Herr Brenner eine neue Reihe einführte. Dann mussten wir diese Reiehe auswendig lernen – ein mal sieben = ?, zwei Mal sieben = ?, drei Mal sieben = ... und so weiter! Danach wurde kreuz und quer gefragt und zum Schluss wurden die bereits behandelten Reihen in die Fragerei hineingemischt. Wir wurden sicher auch mit beträchtlicher Vorsicht an den Zehnerübergang und ähnlich schwierige Dinge herangeführt, um diese Hürden im entscheidenden Augenblick ohne Schwierigkeiten nehmen zu können, doch erinnere ich mich an diese Vorgänge nicht mehr.
Alles in allem verlief die damalige Zeit überhaupt sehr bald in einer Art geordneter Langeweile, über die ich mir gegen Ende der Primarschulzeit zum Beispiel dadurch hinweghalf, dass ich mit meinem Banknachbarn Felix bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine Art Halma spielte, wobei uns mein Rechenkasten und seine mit Blindenschrift bedruckten Stifte sowohl als Spielbrett als auch als Tarnung dienten. Eine zweite Abwechslung bot die Lupe, welche ich seit Mitte der zweiten Klasse benutzte, um im Zeichnen wenigstens einigermassen mithalten zu können. Das Geräusch, das si machte, wenn ich sie – ein Ohr auf den Tisch gepresst - auf ihrem gezackten Plastikrand über die Schulbank rollen liess bis sie ins Torkeln geriet und nach einer langen, allmählich langsamer werdenden Schaukelbewegung auf ihrem dicken Bauch zum Stillstand kam, faszinierte mich immer wieder.
Wir lebten in der Schule mittlerweile vor allem im Stand by Modus, waren bereit, zu reagieren, wenn wir dazu aufgefordert wurden, hingen jedoch meistens unseren eigenen Träumen und Gedanken nach. Es gab zwar auch jetzt noch einzelne Aktivitäten, die aus dem Einerlei des Schulalltags herausragten – die Vorlesestunden am Samstag Vormittag, die aus Hölzern und Bast gebauten Blockhütten, mit denen wir eine „Einheit" zum Thema der „Pfahlbauer" abschlossen oder auch die Zeichenstunden beim bereits erwähnten Lehrer der Parallelklasse, in denen wir mit Ölkreiden, Wachs und Rasiermessern experimentierten. Auch die Aufführung von Max und Moritz oder der Nachmittag, an dem wir uns alle im Keller des Sevögeli um ein Mikrophon drängten, um unser Kunstwerk auf Schallplatte zu bannen und der Tag, an dem wir nach vierjähriger Schulzeit unser Abschlussphoto machten, sind ein paar Momente, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Doch alles in allem beeindruckten mich diese Dinge viel weniger als mein eigentliches, ausserhalb der Schule stattfindendes Leben, die spielend verbrachten Nachmittage im Garten der Freundin M., oder bei T., der Bau unserer Seifenkiste (mit Bremse und Gepäckfach!), die Bauprojekte in den diversen Sandkästen des Quartiers, die Spiele im Park, das Herumstrolchen im Dalbeloch oder die mit Lego, Matador und Stocky verbrachten Regentage.
Ich war das, was man einen "guten" Schüler nennt. Dabei war ich nicht nur gut, weil mein Verstand und mein Gedächtnis in etwa so funktionierten, wie die Schule es in den 1960er Jahren von einem sieben oder zehnjärhigen Jungen erwartete. Ich war vor allem auch deswegen ein guter Schüler, weil ich mich ohne grösseren Protest in die Sache fügte und schnell genug lernte, das beste daraus zu machen. Ich las brav mit, wenn Anneli wieder einmal den Ball holen sollte oder Hansli den Ball hatte. Ich fragte nicht andauernd, wo dieses Anneli wohnt und ob es auch einen Vater hatte. Ich wollte auch nicht unbedingt von unserem Kanarienvogel erzählen, oder wenn ich es vielleicht wollte, so spürte ich doch, dass dies nicht der Ort für ein so vertrauliches Bekenntnis war. Vielleicht hätte der Lehrer ja wieder mit einem leicht ungeduldigen "ja, ja, schon gut, aber jetzt wollen wir weitermachen" reagiert, oder Christoph oder sonst einer unserer Alphatiere hätte gelacht ... Nein. Da sagte ich lieber nichts. Stattdessen gewöhnte ich mich daran, belangloses Zeug zu lesen ohne ständig danach zu fragen, was diese Lektüre mit mir und meiner Welt zu tun hat. Ichmerkte auch, dass dies offenbar ein Verhalten war, mit dem man in der Schule reüssierte, denn wenn ich selber "an der Reihe" war und mit lauter Stimme und ohne zu stocken las "hohl den Ball, Anneli, hol den Ball", dann wurde ich gelobt und es lachte niemand.
Ich nahm es auch hin, dass Esther irgendwann aus unserer Klasse verschwunden war; solche Dinge geschahen offenbar, und es gab keinen Grund, sich deshalb aufzuregen. Ich wollte nicht wissen, wo Esther jetzt sei. Ich wollte auch nicht wissen, ob sie vielleicht traurig sei, weil sie nicht mehr bei uns war. Das heisst, vielleicht hätte ich es schon gerne gewusst, aber auch über solche Dinge redeten wir nicht in der Schule.
Ich gewöhnte mich daran, auch dann meine Hausaufgaben zu machen, wenn ich keine Lust dazu hatte. Ich gewöhnte mich daran, alles, was ich gerade tat, stehen und liegen zu lassen, wenn es Zeit war, in die Schule zu gehen -, kurhz ich gewöhnte mich an ein zunehmend fremdbestimmtes Leben, in welchem die Anforderungen der Schule oberste Priorität haben. Ich gewöhnte mich daran, dass alles vorbereitet und geplant war, und ich nur noch mitzumachen brauchte. Ich gewöhnte mich daran, meine Eigenaktivität so zu dosieren, dass sie den Betrieb nicht störte, und ich gewöhnte mich daran, für mein Wohlverhalten mit guten Noten und mit Lob bedacht zu werden.
Äusserlich betrachtet sieht dies alles harmlos aus, doch im Grunde setzt hier ein Prozess ein, in dessen Verlauf so viel Schaden angerichtet wird, dass es im Grunde unbegreiflich ist, wie wir diesem Trauerspiel Jahr für Jahr zusehen können ohne einzugreifen und das zum Teil deutlich sichtbare, zum Teil unsichtbare Massaker an unseren Kindern aufzuhalten. Es ist ein Prozess, in dessen Verlauf unser Denken und Fühlen, unsere Interessen und unser ganzes Verhalten immer schulförmiger werden. Wir reagieren nicht mehr so, wie wir als "freie Menschen" reagieren würden, sondern wir lernen so zu reagieren, so zu denken und zu fühlen, wie die Schule es von uns erwartet. Es ist ein Prozess, der von Philosophen und Psychologen gerne als Entfremdung bezeichnet wird: Wir gewöhnen uns ganz selbstverständlich daran, dass vieles von dem, was wir interessant oder wichtig finden, nicht interessant und wichtig ist, da es in der Schule keinen Platz hat.
Die meisten ErstklässlerInnen lassen sich bereitwillig auf das ein, was die Schule von ihnen will, doch mit der Zeit setzt eine gewisse Enttäuschung ein, denn zum einen ist das, was einem da Tag ein Tag aus vorgesetzt wird, nicht immer so spannend, wie man ursprünglich dachte. Zum andern möchte man irgendwann doch auch einmal zum Zuge kommen. Doch daraus wird nichts. "Gute" Lehrkräfte fragen zwar immer wieder nach dem, was ihre SchülerInnen zu dieser oder jener Sache denken. Man lässt die geduldigen Kleinen von ihrer Familie oder von den letzten Ferien erzählen, fragt danach, welches ihr Lieblingsgemüse oder ihr bevorzugtes Handy sei, lässt sie dies und das von zuhause mitbringen oder unternimmt sonst allerlei, um ihr "Interesse zu wecken". Doch allmählich merken die Kinder, dass dieses scheinbare Interesse an ihnen und ihrer Welt fast immer nur dazu dient, sie auf ein bestimmtes Thema einzustimmen. Auch wenn im Verlauf solcher Gespräche echtes Interesse an dem entsteht, was ein Kind erzählt: früher oder später wird dieses Interesse gebremst und der Strom des lebendigen Erzählens wird in das Bachbett irgendeines Themas gelenkt, das jetzt bearbeitet werden soll.
Diese "Motivationsphasen" ersparen es den Lehrkräften, die Kinder mit Strenge in ein Thema hineinzwingen zu müssen. Sie geben der Schule den humanen Anstrich, auf den wir heute so stolz sind. Die Kinder aber fühlen sich im Grunde jedesmal betrogen und enttäuscht. Mit der Zeit verlieren sie ihr Zutrauen zu der Sache. Sie gehen gewissermassen in die innere Emigration, hängen während des Unterrichts ihren eigenen Gedanken nach, kritzeln ihre Hefte voll, gucken zum Fenster raus oder beginnen mit ihren Mitgefangenen irgendwelchen Unfug zu treiben, um die Langeweile einigermassen auszuhalten.
Die von der Schule erzwungene Aufteilung unseres Ichs in ein eigentliches, inneres Ich und in ein nach aussen gerichtetes Schauspieler-Ich beginnt bereits früh! Wer sich gegen die von der Schule betriebene, systematische Entfremdung von sich selbst zur Wehr setzt, weil er seine eigenen Impulse und Interessen nicht so leicht aufgeben will oder kann, merkt früher oder später, dass die Schule nicht so harmlos ist wie sie scheint. Zuerst gibt es Gespräche und mehr oder weniger geduldige Ermahnungen, dann folgen Besprechungen mit den Erziehungsberechtigten, damach wird irgend ein schulpsychologischer Beratungsdienst eingeschaltet und wenn auch das nichts hilft, müssen klein Jino oder klein Rea gehen.
Früher brachte man den Kindern dieses Stillsitzen und Mitmachen in der Regel mit Hilfe von Kopfnüssen und groben Prügeln bei. In vielen Schulen der dritten oder vierten Welt - wenn man überhaupt zur Schule ging - ist dies noch immer üblich. Bei uns haben modernere Methoden Einzug gehalten. Wir werden ermuntert und betört. Man erzählt uns, wie wichtig und interessant dieses oder jenes doch sei, bis wir einlenken und "mitmachen", weil wir merken, dass es am Ende etwas zu gewinnen gibt. Was es zu gewinnen gibt, das weiss man zwar nicht, aber jetzt rennt man mit, weil die anderen mitrennen. Diejenigen, die das Tempo nicht durchhalten können oder wollen, scheiden aus. Wer am längsten durchhält ist Sieger. Das ist die offizielle Version der Sache. Auf andere Dinge kommt es nur am rande an. "Lauf Bello, lauf, lauf, lauf!"
Copy Martin Näf, 2003 2018